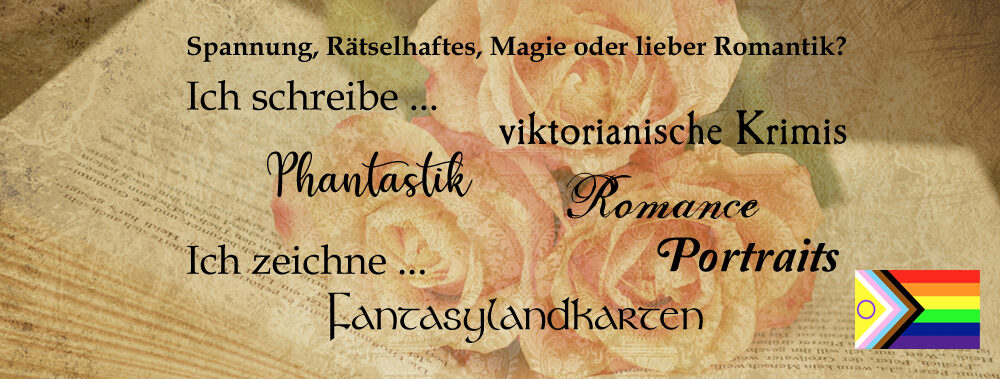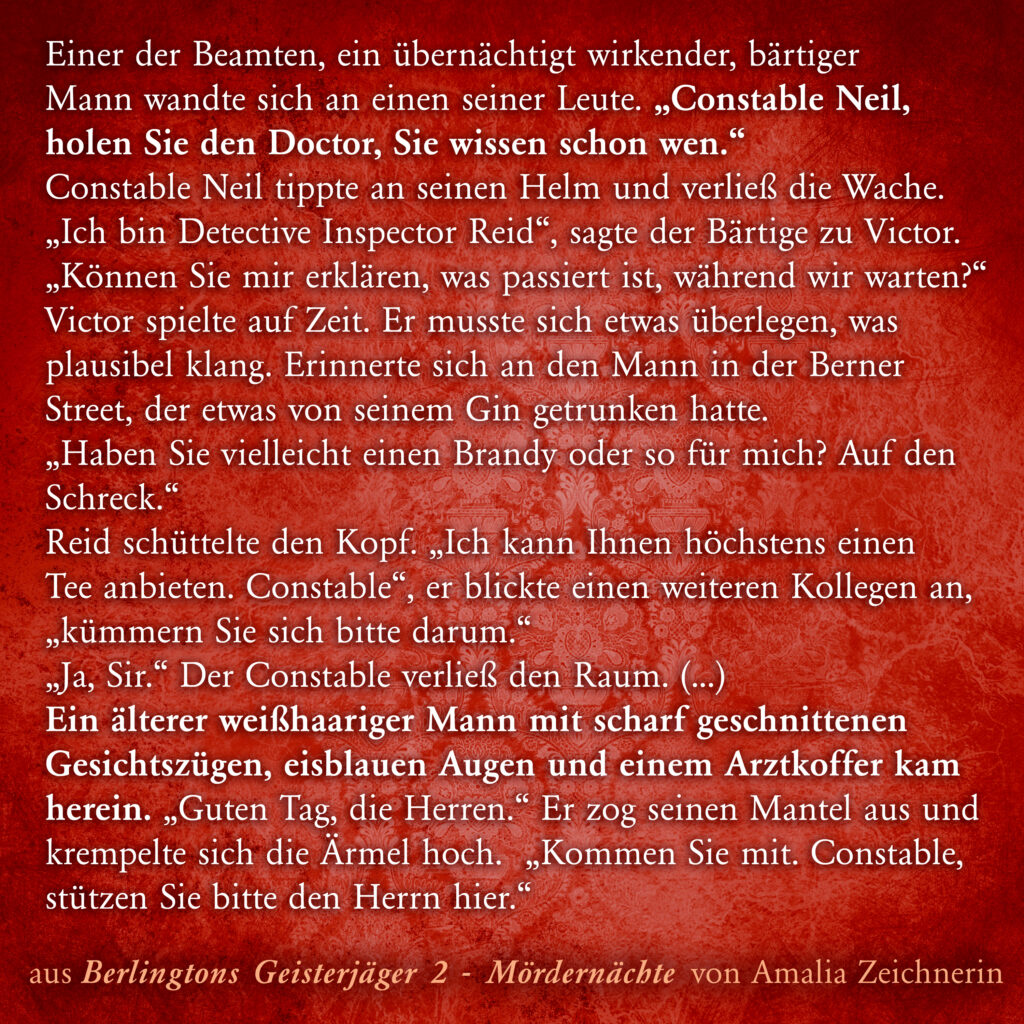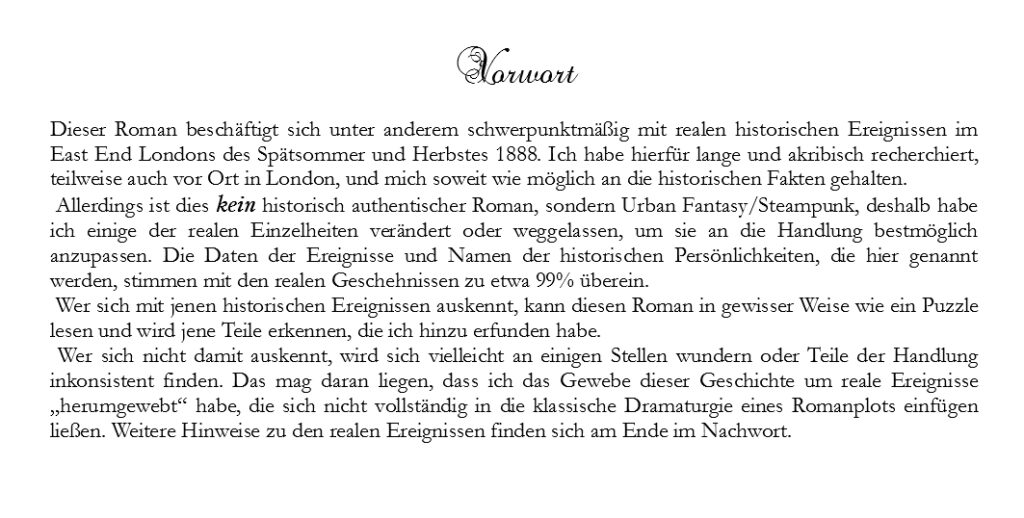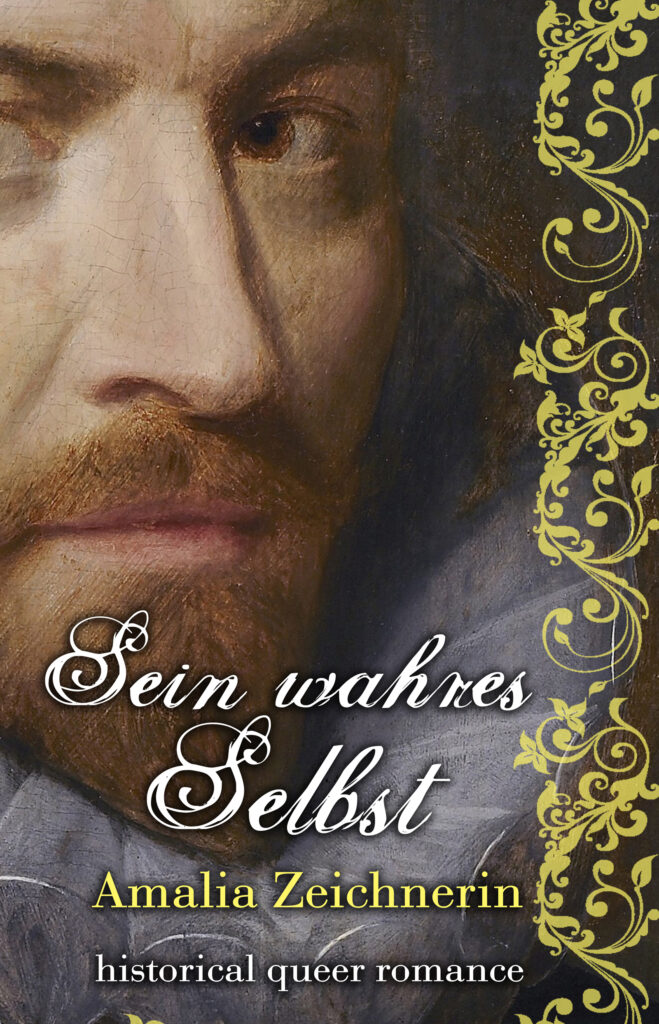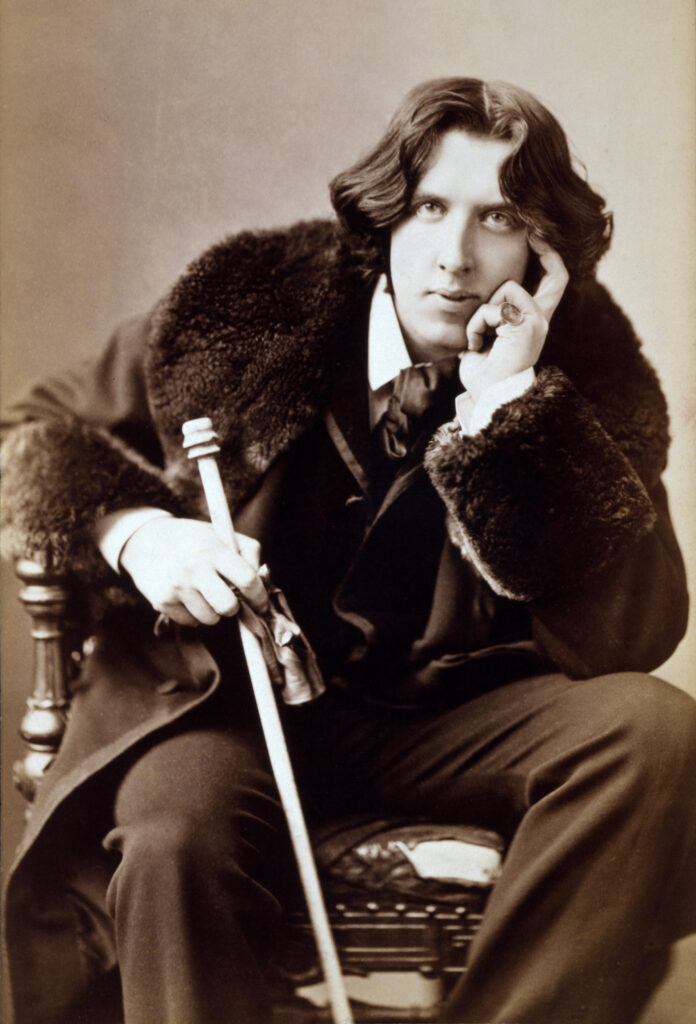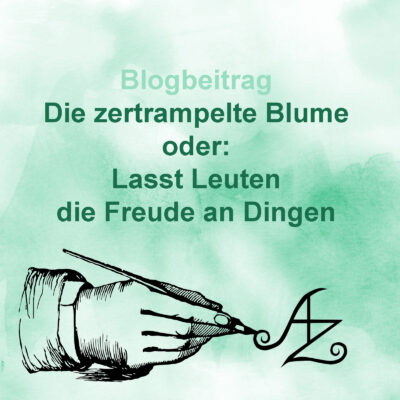
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Stellen wir uns Folgendes vor: Eine Person schreibt in Social Media einen Beitrag über etwas aus der Popkultur, das ihr sehr gut gefallen hat. Ein Game, ein Film, eine Serie, ein Buch, eine Graphic Novel o.ä … vielleicht ist diese Person auch aktiv im entsprechenden Fandom, falls es eines gibt oder kennt bereits mehrere andere Werke der kunstschaffenden Leute, die an dem Werk beteiligt waren.
Ich habe früher auch öfter mal in Social Media von etwas aus der Popkultur geschwärmt. Meine Erfahrung mit solchen Beiträgen: Es dauert oft nur wenige Minuten oder Stunden, bis die erste Person kommentiert: „Ich mochte Film X überhaupt nicht.“
Oder:
„Die Serie Z fand ich total scheiße, weil …“
„Ich habe dieses Buch abgebrochen, was für ein Müll!“
„Dies, das und jenes hat mir gar nicht gefallen.“
Oder ähnliches. Sicherlich habt ihr schon solche Kommentare gelesen, oder vielleicht auch selbst geschrieben. Aus so unterschiedlichen Meinungen können sich theoretisch interessante Gespräche ergeben. Aber oftmals auch nicht, weil die Meinungen bereit feststehen. Oft basieren sie auf unterschiedlichen Geschmäckern, und über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, wie das Sprichwort sagt.
Und ich möchte noch etwas zu bedenken geben: Es ist nicht immer auf den ersten Blick klar, wie viel ein Buch, ein Film, eine Serie etc. einer Person bedeuten oder auch nicht. Ein persönliches Beispiel und da muss ich bisschen ausholen: Ich habe gesundheitlich bedingt viele Schwierigkeiten in meinem Leben und lebe dauerhaft mit Existenzminimum. Ich kann vieles nicht machen, was für andere, privilegiertere Menschen überhaupt kein Problem ist, z.B. Urlaubsreisen oder größere Anschaffungen. Ich kann seit der Pandemie noch weniger als früher machen, weil ich zu den vulnerablen Gruppen, den Risikopatient*innen, gehöre. Ich musste zum Beispiel mein Hobby Fantasy-LARP an den Nagel hängen.
Wenn ich Filme oder Serien sehe oder Bücher lese, die mir richtig gut gefallen, sind diese für mich ein kleiner oder auch größerer Lichtblick zwischen all diesen Schwierigkeiten. Entsprechend bedeuten sie mir viel und ich persönlich möchte mir diese Lichtblicke nicht durch Kommentare kaputt machen lassen, die diese Filme, Serien, Bücher etc. miesmachen.
Ich versuche es mal mit einem Vergleich: Stellt euch vor, ihr habt eine seltene und wunderschöne Blume gefunden und mit nach Hause gebracht. Eurem Partner oder eurem Kind oder einer Freundin gefällt diese Blume aber überhaupt nicht. Anstatt sie euch zu lassen, trampeln sie darauf herum, bis die schöne Blume ganz zerknickt ist. Kein schönes Gefühl, oder? So ungefähr fühle ich mich, wenn ungefragt Dinge miesgemacht werden, die mir gefallen.
Und ich denke, wir alle brauchen Lichtblicke in diesen schweren Zeiten, angesichts all der Krisen in unserer Welt. Und das sieht eben für jeden unterschiedlich aus: Person A hat ein erfüllendes Hobby, Person B liest gern dieses oder jenes Genre, Person C geht gern ins Kino, Person D engagiert sich ehrenamtlich und so weiter und so fort. Mit anderen Worten und da wiederhole ich mich: Ihr wisst vielleicht gar nicht, was einer Person Freude macht oder ihr wichtig ist.
Deshalb, wie wäre denn Folgendes: Wenn ihr Beiträge seht, in denen Leute von einer Sache schwärmen und euch hat diese überhaupt nicht gefallen – scrollt einfach weiter. Das ist nicht schwer und ihr spart euch auch die Zeit, einen Kommentar zu verfassen. Oder fragt erst mal im Sinne von Konsens, ob die Person, die von dieser Sache so schwärmt, eine andere Meinung zu diesem Werk hören möchte oder lieber nicht.
Eine weitere gute Möglichkeit, die ich selbst auch nutze: Wenn ihr eure Meinung oder Kritik über diese Sache (Film, Buch, Serie etc.) kundtun wollt, kommentiert nicht ungefragt bei anderen, sondern schreibt einen eigenen Beitrag, in dem ihr dann auch erzählen könnt, was genau euch daran nicht gefallen hat. Ihr könnt auch dazu schreiben, ob ihr für eine Diskussion bzw. einen Meinungsaustausch offen seid oder nicht. Natürlich könnt ihr auch Rezensionen oder Bewertungen in entsprechenden Portalen, im eigenen Blog, o.ä. schreiben.
Den folgenden englischsprachigen Blogbeitrag habe ich schon öfter empfohlen und er passt auch hier wieder:
»On Spoilers, Critisism and Consent« von Xeledons Spiegel