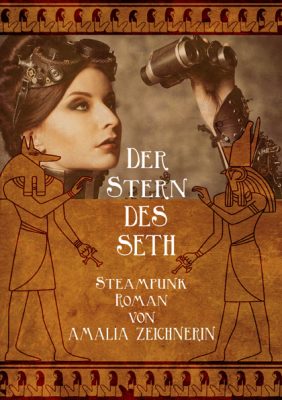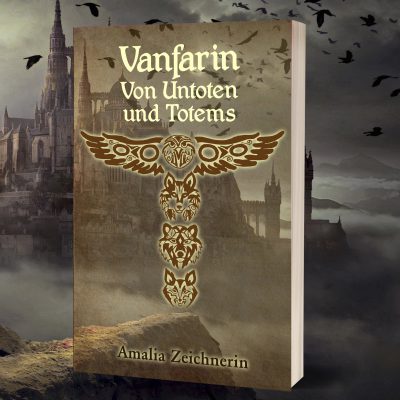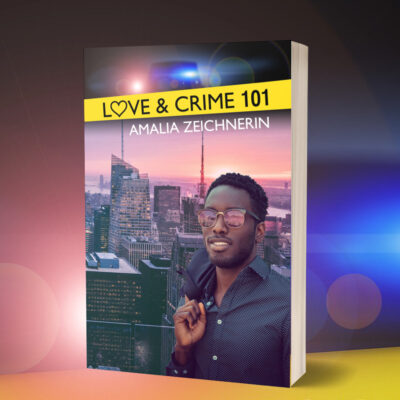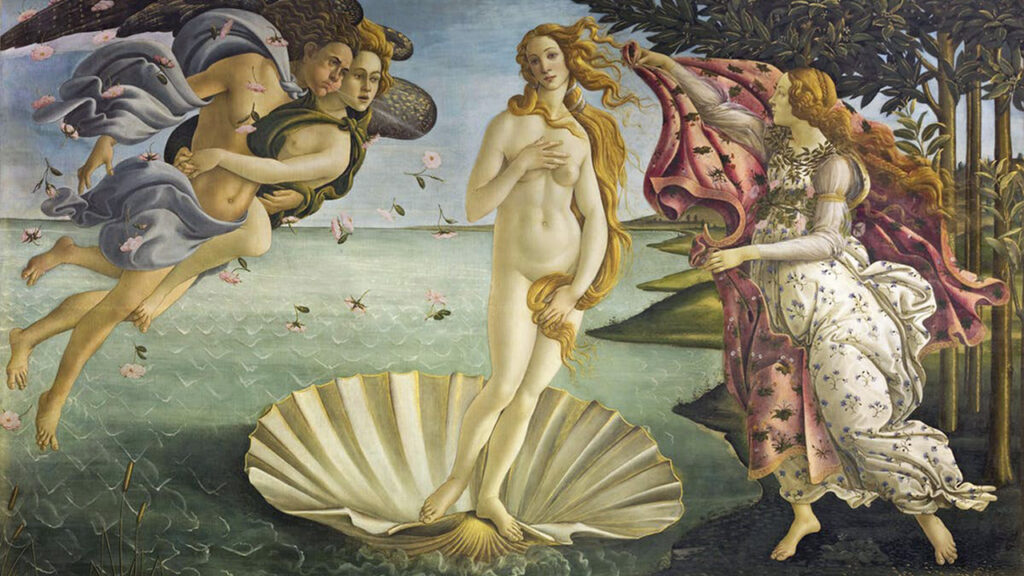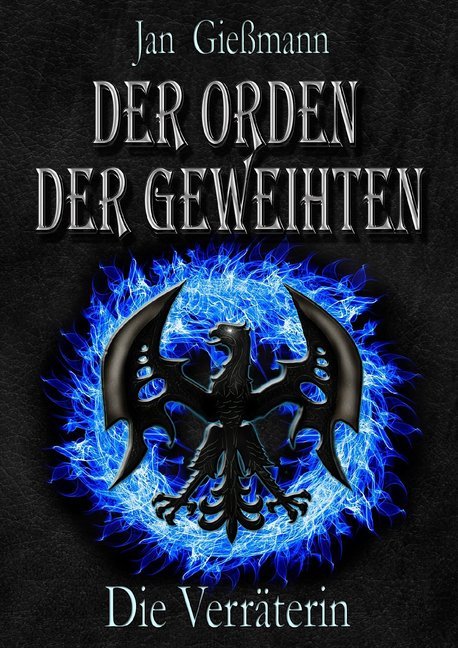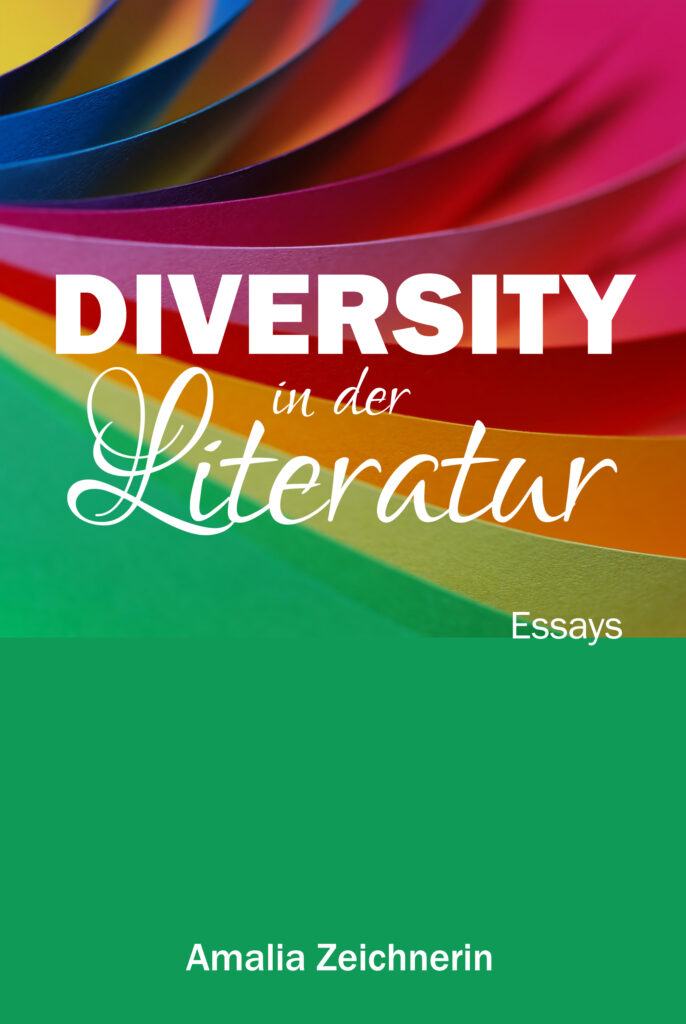Machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2015…
Ich sitze mit Michael O‘Hara, seiner jungen Mitarbeiterin Cathrine „Cat“ Gallagher und seinem Mitarbeiter Duncan McClary im Galwayer Pub Paddy’s. An unserem Tisch sind außerdem der Chief Inspector Brendon Nolan von der Galwayer Polizei (Garda Síochána), sein Kollege Detective Sergeant Alex Donovan, sowie der verdeckte Ermittler und Anderswelt-Cop Connor O‘Sullivan.
Hier im Pub läuft an diesem Abend Musik aus der Jukebox und in einem Fernseher wird das Spiel der Aran-Islands gegen die Four Roads übertragen.
[Passende Musik dazu gibt es z.B. von Erdenstern: „The Pub“ aus dem Album „The Urban Files“, kostenlos hier zum Probehören: https://erdenstern.bandcamp.com/track/the-pub]
Nolan blickt immer mal mit gerunzelter Stirn auf den Fernsehbildschirm, er scheint das Spiel zu verfolgen. O’Hara besorgt eine Runde Pints. Alex Donovan scheint fast unter seiner Schirmmütze zu verschwinden und ist recht schweigsam Miss Gallagher sieht sich von Zeit zu Zeit sichtlich nervös um. McClary und O’Sullivan scheinen sich nicht ganz grün zu sein, aber vielleicht täuscht dieser Eindruck auch …

Duncan McClary, Connor O’Sullivan © Amalia Zeichnerin[/caption]
Nolan zuckt zusammen, als in der Jukebox der Song „Bye bye Miss American Pie“ ertönt und sieht zum Tresen hinüber. Ich warte, bis O’Hara mit den Getränken zurückkehrt.
Vielen Dank, dass Sie sich alle die Zeit nehmen für dieses Interview. Mister McClary, Sie sind ein Daywalker. Für die Nichteingeweihten, die sich mit den paranormalen Wesen nicht gut auskennen, die auch einfach gern Paras genannt werden – was ist ein Daywalker?
Duncan McClary schlägt die Beine übereinander. „Bei uns Daywalkern handelt es sich um Halbvampire. Ein Elternteil ist dabei stets menschlich. Das macht auch den wahrscheinlich wichtigsten Unterschied zu reinrassigen Vampiren aus: Wir werden als Halbvampire geboren und nicht verwandelt, wir leben.“
Ich gehe davon aus, dass Sie wesentlich älter sind als Sie wirken? Ich meine, wenn man es in menschlichen Jahren rechnet? Ist das eigentlich eine unhöfliche Frage?
„Nein, natürlich ist das nicht unhöflich“. beruhigt Duncan McClary mich.“Ich wurde 1819 geboren, bin nun also 196 Jahre alt“
Ah, dann haben Sie gewiss eine ganze Menge erlebt… Wie ist das Verhältnis zwischen Menschen und Paras in Galway? Oder in Irland im allgemeinen? Das Outing der Paranormalen war ja 2005, also schon einige Jahre her.
„Das Verhältnis ist nicht gerade einfach“, beginnt Duncan zögernd. „Weder in Galway, noch in Irland allgemein. Nicht jeder ist bereit, seinem ’neuen‘ Nachbarn zu vertrauen. Sie waren in den Legenden schon immer eine Gefahr.“
„Woran die Presse eindeutig ihren Teil dazu beiträgt“, ergänzt Michael O’Hara.
„Manche schaffen das aber auch ganz alleine für einen schlechten Eindruck zu sorgen“, wirft Chief Inspector Brendon Nolan mit düsterem Blick ein.
Oh, das klingt nach vielen Vorurteilen … und so einigen Problemen zwischen den Paras und den Menschen. Hoffentlich wird sich dies mit der Zeit noch zum Besseren verändern.
Miss Gallagher, Mister O‘Hara und Mister McClary wie kamen Sie auf die Idee, als Kopfgeldjäger zu arbeiten, haben Sie dafür entsprechend passende Ausbildungen gemacht?

Duncan McClary, Cathrine „Cat“ Gallagher © Amalia Zeichnerin
Cat senkt für einen kurzen Moment die Lider. „Ehrlich gesagt war Rache der Grund. Ich wollte, dass der Mörder meiner Eltern seine gerechte Strafe erhält. Und als ich Michaels Stellen-Anzeige las, dachte ich, das wäre die beste Gelegenheit, mein Ziel zu erreichen.“
Ich schweige betroffen. Das klingt nach einem harten Schicksal und alles, was mir gerade einfällt, würde dem nicht gerecht werden.
Duncan nimmt einen Schluck von seinem Pint Guinness. „Ich wollte eine Luftveränderung. Nachdem ich jahrzehntelang mit und für Liam Parker gearbeitet habe und die letzten zehn, elf Jahre im Nachtclub als Sicherheitschef tätig war, wollte ich endlich wieder raus auf die Straße und am Leben Teil haben.“
„Nein, eine Ausbildung braucht man als Bounty Hunter nicht“, übernimmt nun Michael O’Hara das Wort. „Man benötigt natürlich eine weiße Weste bei der Garda Síochána, einen Waffenschein und sollte körperlich in sehr guter Verfassung sein. Ist von den Grundvoraussetzungen also nicht anders wie bei der Detektiv-Lizenz.
Ich verstehe… Sie hatten bis vor einiger Zeit ein Detektiv-Büro, nun haben Sie also eine Hunter-Agentur. Wie kam es zu diesem Wechsel, falls Sie darüber sprechen möchten?
Michael scheint bei seiner Antwort einen kurzen Moment zu zögern, doch dann antwortet er: „Auch wenn’s erstmal widersprüchlich klingt, aber als Kopfgeldjäger kann ich gestrauchelten Paras sehr viel besser helfen, als mit meiner Detektiv-Lizenz. Der Detektiv ist letztendlich nichts anderes als ein Spitzel. Als Hunter spüre ich Kautionsflüchtlinge auf und ja, versuche, wenn es in meiner Macht steht, ihnen zu helfen. Nicht jeder, der auf Kaution draußen ist und untertaucht, ist auch wirklich schuldig.“
Brendon hebt bei der Anmerkung seines Freundes die Augenbrauen, offenbar teilt er seine Meinung nicht ganz.
Können Sie uns verraten, an was für einem Fall Sie aktuell arbeiten?
„Wir haben zur Zeit mehrere Fälle, denen wir nachgehen. Drei, um genau zu sein. Da wäre als erstes eine Hexe, die sich wegen ‚Heimtückischer Verführung‘ verantworten muss. Dann ein Leprechaun, der wieder einmal gegen das Spielverbot verstoßen hat und ein Sidhe, der wegen ‚Überfall mit Todesfolge‘ angeklagt wurde.
Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg damit!
Plötzlich erinnere ich mich, dass unter der Schirmmütze auch noch jemand steckt.

Alex Donovan © Amalia Zeichnerin
Verzeihung, Detective Sergeant Donovan, ich hätte Sie fast übersehen. Sie wurden zur Polizei nach Galway versetzt und arbeiten jetzt mit Chief Inspector Nolan zusammen an einem Fall, richtig?
„Wir gehen davon aus, dass eine Ärztin aus Limerick, hier in Galway Opfer eines Serienkillers geworden ist. Deshalb unterstützen wir in diesem Fall die Kollegen hier in Galway.“
Ah, sehr gut, dass es eine städteübergreifende Zusammenarbeit für solche Fälle gibt. Ich hoffe sehr, Sie finden die Ärztin noch rechtzeitig. Chief Inspector Nolan, Sie sind mit Michael O‘Hara schon lange befreundet, ist das richtig?

Brendon Nolan © Amalia Zeichnerin
„Ja, stimmt, bereits seit unserer Schulzeit“, bestätigt Brendon.
Gibt es da nicht gelegentlich beruflich bedingte Interessenskonflikte – ich meine, Sie arbeiten für die Polizei und Mister O‘Hara als freiberuflicher Kopfgeldjäger…
Brendon schüttelt energisch den Kopf. „Ganz im Gegenteil. Das Aufgreifen von Flüchtigen ist ja kein Wettbewerb, da ist uns jede professionelle Unterstützung recht, die wir bekommen. Schließlich geht es letztendlich ja um die Sicherheit der Bürger, alleine darauf kommt es an.“
Mister O‘Sullivan, verstehe ich es richtig, dass Sie von Limerick aus – was ja von hier ca. 100 km entfernt ist – für eines der drei Reiche der Anderswelt als verdeckter Ermittler arbeiten? Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit verraten oder etwas über diese drei Reiche erzählen?
Connor O’Sullivans Augen waren bis eben auf Brendon Nolan gerichtet, jetzt wandert seine Aufmerksamkeit allerdings wieder zurück. „Richtig, ich arbeite für die Andomhainer Blutgerichtsbarkeit und meine Aufgabe ist es, als verdeckter Ermittler die Paras aufzuspüren, die gegen die ‚Neue Ordnung‘ verstoßen. Neben der Unterwelt Andomhain, die vom Sidhe-Fürsten Liam Parker regiert wird, gibt es noch das Seenreich Lochlann und das Totenreich Ildathach. Und auch, wenn meine Leute und ich für Liam Parker arbeiten, greifen wir auch bei Paras der anderen beiden Reiche durch, wenn diese unsere Gesetze verletzen.“
Apropos Totenreich… Mister O‘Hara, ich hörte, dass es in Ihrem Haus spuken soll. Wer ist denn Ihr geisterhafter Untermieter?
„Ja, die Legende vom Renvyle-House darf wohl in keinem Andersweltbuch fehlen.“ Ein Schmunzeln erscheint auf Michaels Gesicht. „Aber Sie wissen ja, wie das mit Legenden so ist.“
In jeder Legende steckt ein wahrer Kern? Aber ich sehen schon, dass Sie lieber nicht darüber sprechen wollen. Was ich gut verstehen kann, immerhin geht es ja um Ihr neu erworbenes Haus.
Mister McClary, Sie haben bis vor kurzem als Sicherheitschef für den Sidhe-Fürsten Liam Parker gearbeitet, im Club Caer Hafgan. Können Sie uns etwas mehr über den Fürsten und diesen Club erzählen?
„Er schafft es wunderbar, sein Reich und den Club gleichzeitig zu führen, der im Übrigen nicht nur bei den Paras sehr angesagt ist.“ Mehr hat Duncan McClary dazu offenbar nicht zu sagen.
Hmm, das macht mich neugierig. Vielleicht sollte ich diesem Club auch einmal einen Besuch abstatten, wenn ich schon mal hier bin… Im Moment bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für das Interview Slainté!
„Wir haben zu danken“ erwidert Michael und prostet mir, wie alle anderen auch, zu. „Slainté!“
„Und nun entschuldigen Sie uns bitte. Die Pflicht ruft“, sagte Chief Inspector Nolan. Sein Kollege Donovan und Connor O‘Sullivan erheben sich ebenfalls und auch die drei von der Hunter Agentur stellen die ausgetrunkenen Pintgläser ab und verabschieden sich von mir.
Was aus dem Serienkiller-Fall wird? Wie es im Club Caer Hafgan aussieht? Und ob Duncan, Cat und Michael ihre Hunter-Fälle lösen können? Das und vieles mehr kann man nachlesen in „Galway Hunters: Feuertaufe“ von Stefanie Foitzik.
Eine Leseprobe vom Anfang des Romans gibt es hier:
https://stefaniefoitzik.jimdo.com/leseprobe/